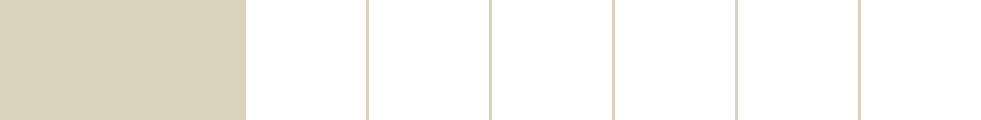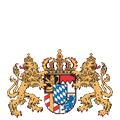Das Fach Wirtschaft und Recht

Ökonomisches Handeln ist wesentlicher Bestandteil unseres Zusammenlebens. Der Unterricht im Fach Wirtschaft und Recht befähigt die Schüler*innen als mündige Wirtschaftsbürger*innen in ihrem persönlichen Lebensumfeld selbstbestimmt ökonomisch zu handeln, in der Gesellschaft wirtschaftliche sowie rechtliche Rahmenbedingungen mitzugestalten und solidarisch Verantwortung für andere zu übernehmen. Dazu erwerben die Schüler*innen Kompetenzen, mit denen sie aus der Perspektive von Konsument, Arbeitnehmer, Unternehmer oder Staatsbürger Problemstellungen kriterienorientiert analysieren, beurteilen und lösen können. Durch die in der Natur des Faches liegende Aktualitätsbezogenheit werden Bildungsinhalte auf gegenwärtige wirtschaftliche und rechtliche Veränderungen wie z.B. die Coronakrise flexibel angepasst.
Um dem Praxisbezug des Faches gerecht zu werden und den Unterrichtsstoff mit Leben zu füllen, pflegen wir den Kontakt zu der Deutsches Bundesbank im Rahmen aktueller geldpolitischer Themen. Darüber hinaus nehmen die Schüler*innen an diversen Planspielen und Wettbewerben teil. Beispielsweise „Playthemarket“, „Planspiel Börse“ oder „Business@school video challenge“. Zusätzlich sind Besuche von Gerichtsverhandlungen beim Amtsgericht in München vorgesehen.
Bei der Vermittlung von Lerninhalten werden im Fach Wirtschaft und Recht besonders digitale Medien eingesetzt wie z.B. die Anfertigung eines Podcast mit den zur Verfügung stehenden IPads an der Schule.
Jahrgangsstufe 9
Neu ist seit dem Schuljahr 2021/2022 das Modul zur beruflichen Orientierung, das einen Umfang von etwa 15 Schulstunden hat. Dieses soll insbesondere dazu dienen, den Schüler*innen bereits in der Jahrgangsstufe 9 einen ersten Einblick in die reale Berufs- und Arbeitswelt zu ermöglichen. Dabei stehen insbesondere die eigenen Interessen der Lernenden sowie deren individuellen Stärken und Fähigkeiten im Vordergrund, welche im Zuge des Moduls von den Schülerinnen und Schülern intensiv reflektiert werden. Vor diesem Hintergrund setzen sie sich mit verschiedenen Berufsfeldern sowie mit aktuellen Entwicklungen der modernen Arbeitswelt auseinander, um eine erste Orientierung hinsichtlich des eigenen beruflichen Werdegangs zu erhalten. Das Modul gipfelt in einem einwöchigen Schülerpraktikum, welches von den Schüler*innen selbstständig und individuell gewählt wird. Die Vermittlung der notwendigen Kompetenzen für die Ausgestaltung der hierfür benötigten Bewerbungsunterlagen, wie beispielsweise Anschreiben und Lebenslauf, sind ebenfalls zentraler Bestandteil der Veranstaltung.
***
Grundlegende Kompetenzen für die Jahrgangsstufe 10
Die Schüler*innen treffen kriterien- und situationsbezogen reflektierte Verbraucherentscheidungen im Bereich des Konsums und im Bereich der Geldanlage. Dabei haben sie auch das Prinzip der Nachhaltigkeit im Blick und sind sich des Einflusses von Werbung und verkaufspsychologischer Maßnahmen bewusst.
Die Schüler*innen wenden das Marktmodell an, um die Koordination durch den Markt an konkreten Beispielen darzustellen, und gleichen die Realität mit dem Modell ab.
Die Schüler*innen analysieren sie betreffende rechtliche Rahmenbedingungen im Hinblick auf zentrale Rechtsfunktionen und schätzen die rechtlichen Konsequenzen ihres Handelns im Zivil- wie auch im Strafrecht ab.
Die Schüler*innen nehmen bei Kaufhandlungen des täglichen Lebens ihre rechtlichen Handlungsmöglichkeiten als beschränkt Geschäftsfähige wahr und machen in Fällen der mangelhaften Leistung ihre Rechte situationsgerecht geltend. Dabei wenden sie Rechtsnormen auf konkrete Sachverhalte an.
Die Schüler*innen treffen im Rahmen eines Projekts, bei dem sie ein einfaches Geschäftsmodell entwickeln, exemplarisch eigene unternehmerische Entscheidungen. Dabei wenden sie im Team grundlegende Methoden des Projektmanagements ergebnisorientiert an und setzen digitale Medien bedarfsgerecht ein.
- Knappheit, Bedürfnisse, Opportunitätskosten, Kosten-Nutzen-Analyse, Wirtschaftlichkeitsprinzip
- Prinzip der Nachhaltigkeit: ökonomische, ökologische und soziale Aspekte
- Techniken der Werbung, verkaufspsychologische Maßnahmen, verhaltensökonomische Effekte
- Überschuldung
- Überblick über wichtige Zahlungsarten
- Kriterien der Auswahl geeigneter Zahlungsarten, z. B. Sicherheit, Kosten, Zweckmäßigkeit
- aktuelle Entwicklungen im Zahlungsverkehr, insbesondere digitale Zahlungsverfahren: Möglichkeiten und Risiken
- Kriterien der Geldanlage: Rentabilität, Liquidität, Sicherheit, ethische Aspekte
- grundlegende Anlagearten, z. B. Spar- und Termineinlagen, Wertpapiere, Immobilien
- Geldwertstabilität, Geldfunktionen
- Marktmodell: Angebot, Nachfrage, Gleichgewichtspreis, Prämissen
- Koordinationsfunktion von Märkten
- Zustandekommen von Verträgen
- Rechte und Pflichten aus dem Kaufvertrag
- Verpflichtungsgeschäft, Erfüllungsgeschäft
- Abgrenzung von Besitz und Eigentum
- Stufen der Geschäftsfähigkeit
- rechtliche Handlungsmöglichkeiten des beschränkt Geschäftsfähigen
- Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer bei behebbaren Sachmängeln beim Verbrauchsgüterkauf
- widerrechtliches Handeln: unerlaubte Handlung, Straftat
- Deliktsfähigkeit, Strafmündigkeit
- Rechtsfolgen von Urheberrechtsverletzungen, z. B. im Internet
- Rechtsfolgen von z. B. Sachbeschädigung, Diebstahl, Körperverletzung
- Funktionen des Rechts
- Rechtsnormen: Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen
- rechtliche Rahmenbedingungen, z. B. Minderjährigenrecht, Gewährleistungsrecht
- Elemente eines Geschäftsmodells, z. B. Geschäftsidee, Marktchancen, ausgewählte Marketingmaßnahmen, Preiskalkulation, Standortentscheidung, Wahl der Rechtsform, Ermittlung von Kapitalbedarf und Finanzierungsmöglichkeiten, Organisation der Leistungserstellung
- Aufbau einer Bilanz: Mittelverwendung (Aktiva), Mittelherkunft (Passiva), Anlage-, Umlaufvermögen, Eigen-, Fremdkapital
- Bilanzveränderungen: Aktiv-, Passivtausch, Bilanzverlängerung, -verkürzung
- grundlegende Methoden des Projektmanagements, z. B. Zielformulierung, Struktur- und Ablaufplanung, Projektkommunikation, -dokumentation, -präsentation, -evaluation
***
Grundlegende Kompetenzen für die Jahrgangsstufe 11
Die Schüler*innen interpretieren gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge mithilfe von Modellen.
Die Schüler*innen nehmen aktiv an der politischen Meinungsbildung in der Sozialen Marktwirtschaft teil, indem sie aktuelle wirtschafts-, sozial- und umweltpolitische Regelungen und Entscheidungen im Hinblick auf Notwendigkeit, wirtschaftliche Effizienz und soziale Gerechtigkeit beurteilen.
Die Schüler*innen beurteilen rechtliche Regelungen und Entscheidungen im Hinblick auf die Erfüllung zentraler Funktionen des Rechts. Dabei beziehen sie auch vor dem Hintergrund der Sozialen Marktwirtschaft grundlegende Wertvorstellungen der Eigentumsordnung im deutschen Recht mit ein.
Die Schüler*innen diskutieren aktuelle Entwicklungen der weltwirtschaftlichen Verflechtung aus verschiedenen Perspektiven. Insbesondere bewerten sie dabei auch Entwicklungen im Rahmen der europäischen Integration.
Die Schüler*innen gehen sicher mit Quellen (z. B. Statistiken, Texte, Karikaturen) zu gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen um. Sie analysieren und interpretieren diese z. B. im Hinblick auf ihre Aussagekraft und die Intention des Autors.
Die Schüler*innen wirken als mündige Staatsbürger an der Gestaltung der ökonomischen Zukunft verantwortungsbewusst mit. Dabei begegnen sie Zukunftstrends in ausgewählten Bereichen offen und konstruktiv.
- Preisfunktionen, z. B. Allokation, Koordination, Signal
- freie Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft
- Grenzen und Risiken der Lenkung durch den Markt: u. a. externe Effekte, öffentliche Güter, unvollkommener Wettbewerb, soziale Probleme
- grundlegende Merkmale der Sozialen Marktwirtschaft: Subsidiarität und Solidarität, Gewährleistung wirtschaftlicher Freiheit und sozialer Ausgleich
- Umverteilung in der Sozialen Marktwirtschaft: Steuern und soziale Sicherung; Belastung eines Privathaushalts mit Steuern und Abgaben, u. a. Einkommensteuer
- Struktur öffentlicher Haushalte, z. B. Bundeshaushalt
- Kreislaufmodell einer geschlossenen Volkswirtschaft mit staatlicher Aktivität
- Sparen und Investieren: Bedeutung für das Wachstum der Wirtschaft
- Begriff des Bruttoinlandsprodukts
- Strukturwandel, u. a. als Auswirkung der Digitalisierung
- Gerechtigkeitsbegriff
- Prinzipien des Rechtsstaats: Rechtssicherheit, Rechtsgleichheit, Rechtsschutz, Unabhängigkeit der Gerichte, Achtung der Grundrechte
- Gliederung des deutschen Rechts: Öffentliches Recht, Privatrecht
- Naturrecht, Rechtspositivismus
- Rechtsfortentwicklung, u. a. infolge fortschreitender Digitalisierung
- Eigentumsordnung: Privateigentum, Wertvorstellung, Inhalt, Grenzen
- Motive für Freihandel (u. a. absolute und komparative Kostenvorteile) und Protektionismus
- ausgewählte Handelshemmnisse, z. B. Zölle, Kontingente, Exportsubventionen
- Kreislaufmodell einer offenen Volkswirtschaft
- Auswirkungen von Wechselkursschwankungen
- Europäische Wirtschafts- und Währungsunion: Freiheiten des Binnenmarktes, Vor- und Nachteile einer gemeinsamen Währung, aktuelle politische Entwicklungen
- aktuelle Entwicklungen und Zukunftstrends in ausgewählten Bereichen, z. B. Arbeitswelt, Finanzmärkte, Wirtschaftsordnung, Weltwirtschaft, Ressourcen