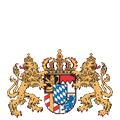Das Fach Latein
Was spricht für Latein als erste Fremdsprache?
Der Umgang mit der lateinischen Sprache übt grundlegende Lerntechniken ein und erzieht zu genauem Lesen und Schreiben. Von Anfang an wird klar: Aufmerksamkeit im Unterricht und regelmäßiges Training führen zum Erfolg.
Der Unterricht ist abwechslungsreich und kindgerecht; neben der Sprache widmen wir uns z.B. dem Alltagsleben der Römer, der antiken Sagenwelt oder archäologischen Funden in Bayern.
Latein ermöglicht die Begegnung mit der antiken Sprache und Kultur; die andersartige Welt der Römer finden Zehnjährige oft besonders interessant.
In diesem Alter wollen Kinder geistig herausgefordert werden und Problemlösungen diskutieren: Der Lateinunterricht gibt Denkanstöße.
Da wir Sprachstrukturen genau untersuchen, beschäftigen wir uns mit der Ausdrucksweise und der Grammatik unserer eigenen Muttersprache. Das kommt dem Deutschunterricht zugute und entlastet ihn.
Lateinkenntnisse erleichtern das Lernen vieler anderer Sprachen. Dies gilt auch für Englisch, das bereits im 2. Jahr einsetzt.
Lernpsychologisch ist ein früher Beginn mit Latein empfehlenswerter als mit dem Einsetzen der Pubertät.
Lehrpläne Latein G 9
Lehrplan Latein G8
Für die Jahrgangsstufen 11 und 12 gilt aktuell dieser Lehrplan…
Grundkompetenzen
Grundlegende Kompetenzen laut LehrplanPlus- für die Jahrgangsstufe 5
- für die Jahrgangsstufe 6
- für die Jahrgangsstufe 7
- für die Jahrgangsstufe 8
- für die Jahrgangsstufe 9
Eine Übersicht über die Grundkenntnisse Latein der Jahrgangsstufen 10-12 (alter Lehrplan) finden Sie hier
Hier finden Sie als Download alle Informationen zu Latinum und Graecum:

Vom helfenden iuvenis zum zürnenden Gott. Augustus und seine Dichter.
Am 15.10.2014 hielt Niklas Holzberg anlässlich des 2000. Todesjahres des Augustus vor den Schülern der Q11 und Q 12 des Wittelsbacher-Gymnasiums München einen Vortrag zu obigem Thema.
Wir danken Herrn Prof. Holzberg für die freundliche Erlaubnis, das Manuskript auf unserer Homepage veröffentlichen zu dürfen.
Marcus Junkelmann: Die Römer im archäologischen Experiment (4.2.2015)
Wenn Archäologen die Lebensverhältnisse im alten Rom und speziell in der römischen Armee rekonstruieren wollen, kombinieren sie hierzu Erkenntnisse aus Bodenfunden (oft Ausrüstungsgegenstände aus Metall, selten aus biologischem Material) mit Informationen aus Bildquellen (also Triumphdenkmälern oder Grabmälern) und Schriftquellen (d. h. Geschichtswerken und Inschriften). Dann gibt es noch die Experimentalarchäologen, zu denen auch Marcus Junkelmann gehört. Diese überprüfen die Annahmen ihrer Fachkollegen im Experiment und korrigieren diese u.U., wie Junkelmann den Schülern der 9. Klassen am Beispiel eines Gladiatorenhelms ausführte. Der 4 kg schwere Helm eines Thra(e)x (“Thraker”) galt den Archäologen meist als Paradehelm, da er aufgrund seines hohen Gewichts zu schwer für den Einsatz in der Arena gewesen sei und deshalb nur bei feierlichen Anlässen Verwendung gefunden habe. Junkelmann widerlegte diese Deutung im Experiment, indem er zeigte, dass der Helm für einen durchtrainierten Erwachsenen keine außergewöhnliche Belastung darstellte, u. a. deshalb, weil er nicht über weite Strecken transportiert werden musste und erst kurz vor dem Kampf aufgesetzt wurde. Dieser Kampf dauerte im übrigen nur maximal 10 Minuten. Der relativ schwere Thrakerhelm konnte also durchaus in der Arena verwendet worden sein.
In das Zentrum seines Vortrags stellte Junkelmann jedoch die Legionssoldaten und ihre Ausrüstungsgegenstände. Von besonderer Bedeutung waren für den Fußsoldaten natürlich seine genagelten Sandalen (caligae); die Nägel, die die Sohlen zusammenhielten, erhöhten nicht nur die Lebensdauer des Schuhs, sondern verbesserten auch die Trittsicherheit. Nur auf Marmorböden rutschte man leicht aus – ein Umstand, der einem römischen General bei der Eroberung des Tempels in Jerusalem zum Verhängnis wurde. Dem Schutz des Körpers diente das aus vielen tausend kleinen Eisenringen zusammengesetzte Kettenhemd, das nur selten auf Bildquellen angedeutet ist und im Boden die Zeiten kaum überdauert. Seine Existenz widerlegt übrigens die Annahme, dass der Panzer des Legionärs (lat. lorica) nur aus Lederteilen (lat. lorum: Riemen) bestanden habe. Lebensrettend konnte neben dem Kettenhemd auch das scutum sein, der etwa 7 kg schwere, lederüberzogene Holzschild. Mit etwa 1,50 m Höhe bot das scutum notfalls dem ganzen Körper Schutz. Primär eine Verteidigungswaffe, wurde der Schild wegen seines hohen Gewichts auch dazu verwendet, den Gegner durch einen gezielten Stoß aus dem Gleichgewicht zu bringen. Reine Angriffswaffen waren hingegen das Kurzschwert (gladius), das vor allem als Stichwaffe eingesetzt wurde, sowie der Wurfspeer (pilum). Mit dem etwa 1,5 kg schweren pilum war im Durchschnitt eine Reichweite von 20 m zu erzielen, wie Junkelmann experimentell erprobt hatte; wenn das pilum einmal durch den Schild des Gegners gedrungen war, konnte es wegen seiner konischen Spitze aus diesem kaum mehr entfernt werden; damit wurde der Schild für den Kampf unbrauchbar, der Gegner blieb ohne Deckung.

Ein weiterer Höhepunkt der Ausführungen Junkelmanns war der diagestützte Bericht über seine 1996 durchgeführte Alpenüberquerung zu Fuß. Von zwei Maultieren begleitet, denen unter anderem der Transport des 60 kg schweren Mannschaftszelts (contubernium) aus Ziegenleder oblag, legten die sieben Archäologen die Strecke von Verona nach Augsburg in insgesamt 24 Tagen zurück. Jeder der modernen Legionäre trug ein Gepäck von 45 kg Gewicht, zu dem auch ein 1,60 m hoher Schanzpfahl aus Eichenholz gehörte. Jeden Abend hoben die modernen Legionäre einen ca. 3,50 m langen Graben mit Wall aus, auf dem die Eichenholzpfähle befestigt und mit Seilen untereinander vertäut wurden: eine erstaunlich stabile Konstruktion, die, wenn verteidigt, kaum zu überwinden oder einzudrücken war.
Die Forschungen Junkelmanns erstreckten sich auch auf die römische Reiterei; im Gegensatz zur Alpenüberquerung dauerte die Vorbereitung der Limesritte deutlich länger, die Anforderungen an Mensch und Tier waren weit höher. Ohne Steigbügel (diese wurden erst im Mittelalter erfunden) schien ein Reiter auf dem Rücken des Pferds kaum Halt zu finden; deshalb waren die Archäologen lang überzeugt, dass die Reiterei im Kampf keine große Bedeutung gehabt haben konnte. Junkelmann zeigte dagegen, dass ein Reiter auch ohne Steigbügel nicht nur fest im besonders geformten Sattel sitzt, sondern von diesem aus auch wuchtige Stöße mit dem Speer führen kann. Erneut war es dem Experimentalarchäologen gelungen, Irrtümer seiner Kollegen am Schreibtisch durch das Experiment zu korrigieren.

Marcus Junkelmann: Die Gladiatur (5.2.2015)
Gladiatorenkämpfe sind bei den Römern zum ersten Mal im 4. Jahrhundert v. Chr. belegt, und zwar im Rahmen des Totenkults. Zu Ehren des Verstorbenen mussten beim Begräbnis von Patriziern Schwertkämpferpaare gegeneinander antreten. Später löste sich der Gladiatorenkampf aus seiner ursprünglichem Zusammenhang: zur Zeit der Republik veranstalteten aufstrebende Politiker Spiele, um sich die Gunst der Wähler zu sichern; in der Kaiserzeit fanden Spiele nur noch unter der Schirmherrschaft des Kaisers statt.
Wer wurde nun Gladiator? Wie die 220 Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen von Marcus Junkelmann in einem kompakten und spannenden Vortrag erfuhren, handelte es sich um Kriegsgefangene, um Sklaven (in der Kaiserzeit verboten) oder zum Tod Verurteilte. Unter den Letzteren gab es drei Gruppen: Wer Glück hatte, wurde ad ludum (“zur Gladiatorenschule”) verurteilt und bekam mit der Ausbildung zum Gladiator eine gewisse Überlebenschance in der Arena. Den sicheren Tod bedeutete hingegen die Verurteilung ad gladium (“zum Schwert”, d.h. zum Massenkampf) oder ad bestias (“zu den Tieren”). Eine weitere Gruppe von Gladiatoren rekrutierte sich aus Freiwilligen, den auctorati (“unter Vertrag Genommene”), die gegenüber dem Besitzer einer Gladiatorenschule in einem Vertrag auf ihre Rechte als freie Römer verzichteten, um sich zum Gladiator ausbilden zu lassen. Über ihre Motive lässt sich nur spekulieren.
Die Gladiatorenausbildung war für den Veranstalter (editor) der Spiele recht teuer; ihm musste also daran gelegen sein, nicht zu viele seiner Kämpfer zu verlieren. Aus Inschriften des 1. Jahrhunderts v. Chr. geht hervor, dass auch nicht jeder Kampf tödlich endete; etwa 10 % der Kämpfe forderten ein Todesopfer. War einer der Kämpfer erschöpft, konnte er durch Austrecken seines Zeigefingers der linken Hand den Abbruch des Kampfes herbeiführen und sich dem Urteil des Publikums stellen. Sofern er tapfer und fair gekämpft hatte, durfte er auf die Entlassung (missio) hoffen. Senkte das Publikum hingegen den Daumen (pollicem vertere), war sein Schicksal besiegelt. Nun wurde erwartet, dass er seinen Tod widerstandslos hinnahm.
Die Schwerter, die die Gladiatoren im Training, in der ersten Runde und oft auch während der gesamten Veranstaltung benutzten, waren aus Holz. Für scharfe Waffen brauchte der Veranstalter der Spiele eine Genehmigung. Wären nur Eisenwaffen verwendet worden, könnte nicht erklärt werden, wie einzelne Gladiatoren bis zu 100 Kämpfe überstanden hatten (dies geht aus Inschriften hervor). Wie alt Gladiatoren im Durchschnitt wurden, ist nicht rekonstruierbar. Die meisten dürften im Kampf gestorben sein; einige wenige wurden nach Beendigung ihrer Karriere Trainer in ihrer Gladiatorenschule (magistri, doctores).
Ursprünglich verwendeten die Gladiatoren Legionärshelme, die außer Wangenklappen keinen Gesichtsschutz hatten, dann Helme mit Visier. Diese waren zwar schwerer (3 – 4 kg), ermöglichten aber einen flüssigen, nicht zur Rückwärtsbewegungen unterbrochenen Kampf. Die Gladiatoren traten immer in bestimmten Paaren gegeneinander an, zum Beispiel der retiarius (“Netzträger”) gegen den secutor (“Verfolger”). Der retiarius war sehr beweglich; in der rechten Hand trug er einen Dreizack, in der linken das Netz. Zusätzlich war der linke Arm durch einen Ärmel aus Wolle und Leder geschützt, der in ein Metallblech zum Schutz des Halses auslief. Der secutor hingegen trug einen Helm, der nur zwei kleine Öffnungen für die Augen aufwies, einen schweren Ganzkörperschild (scutum) und eine Schiene am linken Bein. Er war also besser geschützt, aber auch weniger beweglich als sein Gegner; vor allem schränkte der Helm seine Sicht ein, weshalb er darauf achten musste, den retiarius nicht aus den Augen zu verlieren. Offensichtlich wurde bei den Gladiatorenpaaren darauf geachtet, dass sich Vorteile und Nachteile der jeweiligen Bewaffnung ausglichen und somit Chancengleichheit herrschte. Der Ausgang des Kampfes sollte also offen sein.
7c in Glyptothek und Antikensammlung
Am 20.11.2014 besuchten die 22 Schülerinnen und Schüler der 7c die Staatliche Antikensammlung und die Glyptothek am Königsplatz.
Die Antikensammlung verfügt über eine respektable Kollektion antiker Vasen, anhand derer sich die die Entwicklung der Vasenmalerei von den Anfängen bis in die Kaiserzeit gut nachvollziehen lässt. Von besonderem Interesse sind dabei die unterschiedlichen Produktionstechniken der schwarz- und rotfigurigen Vasenmalerei. Letztere bedarf eines mehrstufigen Brennvorgangs, dessen Beherrschung ein hohes Maß an Erfahrung voraussetzte. Nicht immer ging alles glatt, wie einige “Fehlbrände” zeigen.
Die Vasenbilder bieten nicht nur bekanntere und unbekanntere Episoden aus der Mythologie, manchmal gewähren sie auch einen Einblick in das Alltagsleben der Griechen. Hier sehen wir z.B. eine Szene aus dem Sport:
In der Glyptothek lernten die Schüler mit den Giebelfiguren des Aphaiatempels, den sog. Ägineten, und dem Barberinischen Faun deren bekannteste Exponate kennen und konnten dabei auch die Entwicklung des Kontraposts in der Bildhauerei nachvollziehen. Im Saal der römischen Bildnisse wurden vor allem die Büsten der Kaiser Nero und Augustus genauer betrachtet und deren Erkennungsmerkmale erarbeitet.
Auf dem Bild rechts steht die Gruppe vor dem “Knaben mit der Gans”, einem Massenprodukt aus hellenistischer Zeit, das in mehreren Kopien in verschiedenen Museen erhalten ist.